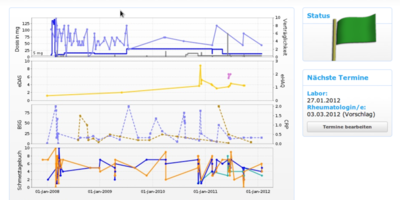Rheuma Update für Rheumatologische Fachassistenzen
Die Fortbildungsveranstaltung fand kürzlich in Köln statt und richtet sich an medizinisches Assistenzpersonal aus Rheumatologischen Praxen und Kliniken.
„Sport und Herz“ – die Komorbiditäten in der Rheumatologie
70 % aller Erkrankungen sind heute vermeidbar, Typ II Diabetes, Hypertonie, KHK, Asthma, COPD und ähnlichen kann wirkungsvoll durch Sport entgegengewirkt werden. Sport wirkt tumorpräventiv, kann Alzheimer und Demenz verhindern und wirkt protektiv bei Arthrose. Sport ist eine effektive Therapie des Diabetes. Sport hat eine antidepressive Wirkung, verbessert die Herz- Kreislauffunktion, wirkt antiinflammatorisch und führt zu einer Reduktion der kardiovaskulären Mortalität. Regelmäßige Bewegung wirkt lebensverlängernd und kann sogar helfen, Medikamente einzusparen.
Früher war Bettruhe eine der häufigsten Maßnahmen bei vielen Erkrankungen, heute wird sogar nach Operationen eine frühzeitige Mobilisierung empfohlen.
Rheumapatienten haben ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, das Risiko von Morbiditäten und auch die Mortalität sind erkrankungsbedingt erhöht. Hinzu kommen ein erhöhter Blutdruck, eine Dyslipidämie, eine metabolische Dysregulation sowie die Thrombophilie. Rauchen verstärkt diese Risiken zusätzlich, all das fördert die Inflammation. Der Verlauf einer rheumatischen Erkrankung wird durch eine schlechte Therapieeinstellung negativ beeinflusst. Sarkopenie – Muskelschwund in zunehmendem Alter und eine eingeschränkte Mobilität führen zur Gebrechlichkeit, zu einer Muskelschwäche bis hin zum Tod. Körperliche Aktivitäten haben einen positiven Effekt auf alle Körperfunktionen. Nicht das Alter macht gebrechlich, sondern die Unbeweglichkeit. Ein reduzierter Fitnessstatus bei körperlicher Inaktivität führt zu einer um 30 % reduzierten Kraft und Ausdauer, vergleichbar mit einem 25 Jahre älteren Gesunden.
Durch eine effektive Rheumatherapie wird eine bessere Beweglichkeit erreicht. Durch die T2T- Strategie mit einer effektiven Krankheitskontrolle kann eine Remission erreicht werden.
In den letzten Jahren wurde die Funktion des Muskels als endokrines Organ wieder entdeckt. Auch für das Fettgewebe konnte eine sekretorische Funktion, proinflammatorischer Art nachgewiesen werden. Muskelzellen habe eine hohe sekretorische Kapazität, die Myokine.
Die Entdeckung dieser Moleküle weist die Wirkung auf das Muskelsystem nach, insbesondere auch auf die Bedeutung von körperlicher Aktivität, Bewegung und Krafttraining für die Gesundheit. Zuerst wurde das Myokin Interleukin 6 (IL-6) entdeckt, dieses Myokin ist am besten untersucht, man weiß, dass die sekretorische Menge im Verhältnis zur vorhandenen Muskelmasse während des Trainings ansteigt. IL-6 spielt in der Fettoxidation und bei der insulinvermittelten Glukoseaufnahme eine große Rolle und beeinflusst den Stoffwechsel der Muskulatur mit.
Myokine sind für die protektive Wirkung von Sport und körperlicher Bewegung auf die Gesundheit verantwortlich.
Der Energiesensor Myostatin hat mit dem Muskelwachstum zu tun.
Sporttherapie wirkt antiinflammatorisch und hat eine positive Wirkung auf die kardiorespiratorischen Funktionen.
Ebenfalls hat man neuropsychogene Effekte durch Bewegung entdeckt, beispielsweise bessert sich die Fatique, das bleierne Müdigkeitssyndrom, unter einer Bewegungstherapie. Sport bewirkt eine metabolische Reprogrammierung auf die Insulinresistenz, auf das viszerale Fett und auf das Lipidprofil.
Sport führt weder zur Verschlechterung, noch zur Krankheitsexazerbation. Sport gilt als Trigger für eine Lebensveränderung. Vorteilhaft ist eine hohe Intensität. Das Therapieansprechen verbessert sich, ebenso zeigt sich eine verbesserte Schmerztoleranz. Zusätzlich verstärken eine gesunde Ernährung und ein Verzicht auf Tabak und Alkohol diesen Effekt.
Die Sporttherapie sollte eine Mischung aus Ausdauertraining, Flexibilität und Krafttraining sein.
Barrieren für eine Sporttherapie sind Erschöpfung, Zeitmangel, Bequemlichkeit, Schmerz, Stress und Angst vor Schädigung. Die körperliche Aktivität muss sich in den Alltag integrieren lassen, auch ein kurzes sportliches Training mit hoher Intensität hat einen positiven Effekt und beeinflusst den Muskelaufbau, fördert den Fettabbau und führt zu einer verbesserten körperlichen Aktivität.
Sportverletzungen können durch eine gute Vorbereitung minimiert werden. Der plötzliche Herztod ist bei Athleten selten.
Sport als Therapie ist eine effektive Maßnahme, die auch von Ärzten noch viel zu sehr unterschätzt wird. Die Umsetzung ist oft schwierig, durch fehlende Zeitvakanzen. Es gilt Barrieren abzubauen, Ängste zu nehmen, auf Gelenkschutz durch Bandagen hinweisen, ebenso sollte die Sportart entsprechend dem jeweiligen Krankheitsbild und unter Berücksichtigung des Fitnesszustandes ausgewählt werden.
Spezialisierte Fachassistenzen können hier beraten und begleiten. Erstellt wird ein strukturiertes Patientenprogramm. Ärzte sollten die Wichtigkeit der Bewegungstherapie als speziellen Fortbildungsschwerpunkt vermittelt bekommen, denn: Sport ist wichtig!
Patienten, die bereits Sport betrieben haben, sind leichter zu motivieren. Wichtig ist ein regelmäßiges Training, und wenn es nur täglich 5 – 10 Minuten sind! Aber: Sport muss auch Spaß machen!
Das 1 x 1 der Bildgebung
Bildgebung bedeutet viele verschiedene Bilder durch unterschiedliche Methoden angefertigt.
Fotografie, z. B. zu Dokumentationszwecken, Techniken aus der Radiologie, beispielsweise das Röntgen. Das Röntgen wurde im 19 Jahrhundert entdeckt, dort aber noch mittels sehr aufwändigen Techniken. Eine gute Dokumentation hierzu ist im Röntgenmuseum in Remscheid zu besichtigen.
Die Rheumahand gilt als Visitenkarte.
Röntgen wird zur frühzeitigen Darstellung von Schäden des Knochens angewendet.
Zum Einsatz kommt bei Vaskulitiden auch die Kapillarmikroskopie.
Die Bildgebung ist ein wichtiger Bestandteil der Erstdiagnostik, zum Nachweis eines Erguss, einer Synovialitits, einer Tenosynovialitis sowie zum Nachweis von Ödemen des Knochenmarks.
Bildgebung kommt zum Einsatz auch zur Kontrolle von Strukturveränderungen im Verlauf, zur Feststellung einer Degeneration des Knorpels oder am Knochen.
Bildgebung ist für die Patienten nur mit einer geringen Belastung verbunden, nicht alle Verfahren stehen überall zur Verfügung. Mittels Bildgebung kann eine Abschätzung der Prognose erfolgen, Komorbiditäten können erfasst werden, Bildgebung erfolgt auch zur Entscheidung zu einer Therapieintensivierung, Bildgebung ist auch Bestandteil der Diagnosestellung.
Bei den Klassifikationskriterien fehlt die Bildgebung noch.
Frühdiagnostik:
Röntgen:
In der Frühsprechstunde, zur frühen Diagnosestellung und zum Entscheid zu einer frühen Therapie, noch lange bevor Röntgenschäden sichtbar sind. Trotzdem kann bereits dort eine manifeste Erkrankung vorliegen.
Ein konventionelles Röntgenbild, meist in 2 Ebenen durchgeführt, sollte zu Beginn der Erkrankung und im weiteren Verlauf erfolgen. Der Strahlenschutz muss beachtet werden.
Schrägaufnahmen lassen Schäden oft besser erkennen. Geröntgt werden sollten immer beide Gliedmaßen zum Vergleich. Eine Vergrößerung ist beim digitalen Röntgen kein Problem mehr. Dargestellt werden „Wetterecken“, Frühveränderungen als Frühzeichen einer Rheumatoiden Arthritis.
Auch ein Röntgenbild beider Füße gehört zur Frühdiagnostik, häufig zeigt sich im 5. Strahl eine frühe Veränderung. Eine Abgrenzung zur Arthrose kann erfolgen.
Bei der RA sollte auch die Halswirbelsäule mit geröntgt werden. Im Röntgenbild der Handwurzel (Os Karpale) zeigen sich eventuelle irreparable Schäden.
Scoring- Röntgen: zur globalen Bewertung pro Gelenk.
Das konventionelle Röntgen gilt als Goldstandard der bildgebenden Verfahren, Nachteile ist, dass diese Methode nicht ausreichend sensitiv ist für eine Frühdiagnose und ebenso nicht anwendbar ist zur frühen Therapiekontrolle, da Erosionen erst nach 3 – 6 Monaten sichtbar werden.
Sonographie:
Ultraschall ist die Methode in der Praxis, sozusagen der „verlängerte Arm des Rheumatologen“. Erfasst werden können Weichteile, Schwellungen, eine synoviale Proliferation und Ergüsse. Auch werden gerne ultraschallgesteuerte Punktionen durchgeführt.
Der Ultraschall gilt als Standard Verfahren. Es werden viele Schulungen angeboten. Zur Erfassung der Krankheitsaktivität ist der Power- Doppler hilfreich. Darstellen lassen sich Entzündungen von Weichteilen. Eine hohe Krankheitsaktivität führt auf lange Sicht zur Erosivität.
Sonographiebefunde werden auch zum Scoren eingesetzt, die Duplex- Sonographie findet zusätzlich Einsatz zur Diagnostik einer Polymyalgia Rheumatica und einer Arteriitis temporalis, hier wird die Entzündung im Gefäß sichtbar. Hier ist die Untersuchung unverzichtbar zur Verhinderung von Blindheit. Bei Vaskulitiden, insbesondere bei der Riesenzellarteriitis ist das Sichtbarmachen von Gefäßentzündung zur Diagnosesicherung und Abgrenzung zu anderen Krankheitsbildern wichtig.
Ultraschall ist ein kostengünstiges Untersuchungsverfahren, mit guter Verfügbarkeit. Leider sind diese Untersuchungen noch nicht flächendeckend abrechnungsfähig.
MRT:
Die Magnetresonanztherapie ist ein strahlungsfreies Untersuchungsverfahren mittels Schnittbildgebung, hier sind jedoch auch Fehlinterpretationen möglich, häufig wird Kontrastmittel nötig, das Verfahren ist sehr teuer, die Untersuchung erfordert einen hohen Zeitaufwand, es ist nur jeweils eine Region abbildbar. Kontraindikationen sind Metallimplantate, hier gilt es die Herstellerliste zu beachten. Am Patienten verbliebene Metallgegenstände (Piercing!) führen zu großen Schäden am Gerät, deren Beseitigung dauert in der Regel 3 Tage und ist kostenintensiv, insbesondere beim Hochfeld- MRT.
Früher wurde Kontrastmittel sorgenfrei eingesetzt, heute weiß man, dass Kontrastmittel zu Nierenschädigungen und Ablagerungen im Kopf, mit der Folge von neurodegenerativen Erkrankungen führen kann. Vor Kontrastmittelgabe muss daher stets die Nierenfunktion bestimmt werden. Daher sollten heute eher kontrastmittelfreie Untersuchungen durchgeführt werden.
Das MRT wird eingesetzt zur Frühdiagnostik, zur Differentialdiagnostik, zur Prognoseeinschätzung und zur Therapiekontrolle. Heute sind hochauflösende Geräte im Einsatz, so lassen sich Schäden schon nach 2 – 3 Monaten darstellen. Aus einem Knochenmarksödem entwickelt sich ohne Therapie eine Erosion.
Das MRT wird auch zum Scoring eingesetzt, in den Klassifikationskriterien, beispielsweise der SpA hat die MRT- Untersuchung bereits Einzug gehalten. Hierdurch ist eine schon frühe Möglichkeit der Darstellung gegeben.
DECT: Duale Energy- CT:
Hierdurch können beispielsweise differentialdiagnostisch bei der Gicht Gichtkristalle (Calcium im Knochen und Natriumurat) nachgewiesen werden.
Die Untersuchung ist Kassenleistung!
Rheumascan: Ist keine Kassenleistung. Hier wird ein fluoreszierender Farbstoff intravenös injiziert, dann werden Bilder erstellt. Nachweisen läßt sich mit dieser Methode eine erhöhte Entzündungsaktivität. Die Untersuchung ist sehr zeitaufwändig.
Kapillarmikroskopie:
Diese Methode zeigt Gefäßveränderungen der Nagelfalz an, wie sie beispielsweise bei der Sklerodermie auftreten. Das Verfahren findet heute wieder vermehrt Anwendung. Der Nachweis von Antikörpern und die Gefäßveränderungen in der Kapillarmikroskopie erhöhen ergänzend zu Klinik und Labor die Diagnosesicherung.
Nuklearmedizinische Verfahren:
SPECT- Szintigraphie, Hybridverfahren: Nuklearmedizinsicher- und Radiologischer Verfahren addieren, z.B. bei PET CT u. –MRT. Diese Methode ist sensitiver, aber nicht spezifisch.
Viele Techniken werden eingesetzt, das erfordert eine Weiterbildung von Arzt und MFA.
Es gibt keine Methode für Alles! Hilfreich in der Diagnostik sind Kombinationen der einzelnen Techniken.
Was gibt es Neues in der Behandlung der Rheumapatienten?
S3- Leitlinien:
2019 wird auf dem europäischen Rheumakongress „EULAR“ in Madrid ein neues Leitlinien- Update vorgestellt.
Die AWMF- AG (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V., www.awmf.org ) – das Portal der wissenschaftlichen Medizin veröffentlichst und regelt Leitlinien und Standards.
Die S3 Leitlinien sind der höchste Evidenzgrad, viele Fachgruppen erarbeiten diese Standards mittels systematischer Literatur- Recherche, strukturierter Konsensfindung, Qualitätsstandards und –Evidenz.
Studien mit Kontrollgruppen haben hohe Evidenzen haben.
Die Leitlinien beinhalten Empfehlungsgrade. Der Empfehlungsgrad „SOLL ist eine MUSS- Empfehlung“, „SOLLTE“ stellt keine hohe Empfehlung dar, das bedeutet soviel wie „KANN erwogen werden“ – und ist somit keine bindende Empfehlung.
Konsensstärke wird durch große Gremien und eine individuelle Entscheidungsbindung erreicht.
Die bisherigen Leitlinien für die RA sind bis zum 30.08.2016 gültig, kürzlich wurden die neuen S3 Leitlinien auf dem EULAR- Kongress veröffentlicht. Dieses Update war dringend notwendig, da die bisherigen Leitlinien bereits aus 2011 stammten!
Bei den neuen S3 Leitlinien haben 20 Verbände mitgewirkt.
Nach den EULAR- Recommendations 2016 sollten zu Therapiebeginn MTX in Kombination mit Glucocorticoide 30 mg eingesetzt werden. Nach 3 Monaten sollten die Glucocorticoide abgesetzt werden, das Ziel ist eine steroidfreie Therapie!
In der Phase II können zusätzlich zum MTX Biologika oder JAK- Inhibitoren eingesetzt werden.
Prognostisch ungünstige Faktoren bedeuten eine Ausnahmesituation.
Die Frage: wann und was soll reduziert werden entscheidet über „MUSS“ oder „KANN“ und „SOLL“ oder „SOLLTE“- Empfehlungen.
Ist der Einsatz von Glucocorticoiden Segen oder Fluch? Patienten mit einem hohen Steroidbedarf haben erhöhte Risikofaktoren für unerwünschte Ereignisse – Adverse Events (AES), vor allem für Infektionen etc.
Nach 12 Wochen müssen die Glucocorticoide abgesetzt sein, eine Erhaltungsdosis als Steroiddauertherapie sollte heute nicht mehr verabreicht werden!
Selbst 5 mg Glucicorticoide als Low- Dose- Dauertherapie machen Ödeme, Infekte und Schlafstörungen, die alte Ansicht, dass Dosen von unter 7,5 mg Glucocorticoide gut wären, ist heute nicht mehr relevant.
Selbst hier treten schwere Nebenwirkungen auf, wie ein cushingoider Phänotyp, Schlafstörungen, ein erhöhter Blutdruck und vieles mehr! Das Ziel ist heute daher, die Kortisondosis auf Null zu bringen.
Der DAS 28 ist heute eher niedriger, aber heute bekommen auch 50 % aller Patienten dauerhaft Kortikoide verabreicht. Das führt häufig zu Frakturen, Diabetes und Vielem mehr! Immer noch erhalten 48 % aller Patienten 5 mg Glucocorticoide als Dauertherapie!
Hier gilt es dringend, eher die Basistherapie anzupassen, als den Steroidbedarf zu erhöhen.
Bis zum Erreichen der Wirksamkeit einer Basistherapie können 30 mg Glucocorticoide verabreicht werden, diese sollten jedoch in 8 Wochen auf eine Dosis von 7,5 mg reduziert werden, und nach 12 Wochen komplett wieder abgesetzt werden.
Körperliche Aktivität und Sport:
Körperliche Belastung löst eine Botenstoffausschüttung aus, die die Krankheitsaktivität senkt! Die chronische Entzündungssituation hat Einfluss auf die körperliche Aktivität, durch eine Steroiddauertherapie steigt das Gewicht, das Körperfett nimmt zu, dies führt zu Gefäßveränderungen, Ateriosklerose, einem erhöhten kardiovaskulären Risiko und zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson.
Körperliche Aktivität und Sport erzeugen einen körperlichen Reiz, daraufhin werden antiinflammatorische Botenstoffe ausgeschüttet. Das ist eine gute Reaktion. Sport ist ungefährlich und führt auch nicht zu vermehrter Erosion. Schonen ist out! Vielmehr wird eine funktionsangepasste Bewegungstherapie empfohlen.
Die EULAR 2018 Empfehlungen zur körperlichen Aktivität für Patienten mit RA, SpA und PsA gelten auch für Gesunde!
150 Minuten körperliche Aktivität pro Woche sind eine moderate Belastung, oder 60 Minuten intensive körperliche Betätigung pro Woche verbessert bereits evidenzbasiert die Gesundheit!
Sport ist sicher!
Individuelle Programme sollten die Präferenzen und Möglichkeiten des jeweiligen Patienten mit einbeziehen. Die Motivation des Patienten zu mehr körperlicher Aktivität, je nach dessen individuellen Vorlieben und Fähigkeiten sollte gefördert werden.
Zukunftsvisionen:
In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Medikamente zur Behandlung entzündlich- rheumatischer Erkrankungen auf den Markt gekommen. Auch die Technik schreitet unaufhaltsam voran. Beispielsweise kann der Ultraschall schon auf dem Smartphone sichtbar gemacht werden. Ebenso können EKGs aufs Smartphone übertragen werden. Rettungswagen sind bereits mit Sonographiegeräten ausgestattet, heute können viele Dinge, die bisher nur mittels PC getätigt werden konnten auf dem Smartphone gemacht werden, selbst Wärmebildkameras auf dem Smartphone sind bereits möglich.
Genome sind Zukunftsvisionen, mit Trecking über das Smartphone und Imaging, hier fallen große Datenmengen an, der Begriff „Big Data“ wird somit auch in der Rheumatologie Relevanz finden.
Die neuen S3 Leitlinien sind praxisrelevant. Der Umgang mit Glucocorticoiden muss umgesetzt werden. Sport ist safe, die körperliche Aktivität sollte wieder ein fester Bestandteil der Therapie sein!
Neue Forschungsansätze und Big Data haben bereits, oder werden zeitnah Einzug in die Rheumatologie halten und bieten neue Möglichkeiten für die Forschung und die klinische Versorgung. Auch die Künstliche Intelligenz ist hier ein Thema.
ASV – Chancen und Hindernisse – aus Sicht des Arztes und der RFA
Die Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung – ASV hat „topic“ in der Berufspolitik für Rheumapatienten und die Zukunft in der medizinischen Versorgung. Die Versorgung erfolgt ambulant, interdisziplinär und intersektoral.
Die Ermächtigungsambulanzen sind sehr beschnitten, dort sind nur konsiliarische Behandlungen mit Delegation an den Hausarzt möglich.
Daraus entstand die Idee der ASV, Krankenhäuser sollen Patienten ambulant versorgen, dies wurde zunächst durch die Versorgung nach § 116b SGB V in der alten Fassung geregelt.
2017 sind nur 30 Fachärzte für internistische Rheumatologie dazugekommen. Das kann den Bedarf niemals adäquat decken.
Das Ziel der ASV ist seltene und komplexe Erkrankungen zu therapieren mit hochspezifischen Leistungen, z.B. PET- CT etc. Krankenhäuser und Fachärzte im niedergelassenen Bereich arbeiten hier Hand in Hand und sichern so eine interdisziplinäre Patientenversorgung auf hohem Niveau mit kurzen Wegen. Es gelten für beide Berufsgruppen die gleichen Bedingungen.
Für die ASV gilt eine eigene Abrechnung, am EBM orientiert. Einzelleistungen werden extrabudgetär vergütet. Behandelt werden onkologische-, rheumatologische-, HIV- u. Aids- Herzinsuffizienz- MS- Erkrankungen und viele mehr, eingeschlossen sind alle rheumatologischen Erkrankungen außer Gicht.
Konkretisierung: Nahezu alle Rheumatischen Erkrankungen sind includiert.
Gründung einer ASV- Ambulanz:
Der Teamleiter muss ein internistischer Rheumatologe sein, es können auch weitere Rheumatologen ins Team aufgenommen werden.
Das Kernteam besteht aus Orthopäden, orthopädischen Rheumatologen, Nephrologen, Gastroenterologen, Pulmologen, Dermatologen und Ophtalmologen, das Team besteht aus 16 Fachgruppen, die in maximaler Entfernung von 30 Minuten erreichbar sein müssen. Empfehlungen zu bestimmten Ärzten sind gestattet.
Der Erweiterte Landesausschuss (ELA) nimmt den Antrag entgegen. Das Sprechstundengebot vor Ort ist gestrichen worden, jetzt gilt, wenn der Patient eine gemeinsame Sprechstunde wünscht, muss diese am Ort des Teamleiters gestattet werden.
Es gibt statt der lebenslangen Arzt- Nr. - LAN- Nr eine ASV- Team- Nummer.
Die Prüfung des Antrags dauert ca. 8 Wochen, ein Kooperationsvertrag ist notwendig, jeder Leistungserbringer rechnet seine eigenen Leistungen für sich mit der Krankenkasse direkt ab, die Weitergabe an die KV ist gegen Entgelt möglich. Hinzuziehende Fachärzte brauchen eine Überweisung, im Kernteam ist keine Überweisung erforderlich. Es gibt auch eine Vertretungsregelung.
Im Jahr müssen mindestens 240 Patienten gesehen werden.
Eine enge Zusammenarbeit mit Physio- und Ergotherapie, sowie mit einer Orthopädietechnik ist ebenso erforderlich. Auch eine Patientenschulung muss integriert sein.
Wenn ein Patient mit einer Verdachtsdiagnose in die ASV eingeschlossen wird, muss die Diagnose sich innerhalb von 2 Monaten bestätigt haben, ansonsten kann der Patient nicht in der ASV bleiben.
Die Überweisung erfolgt vom Hausarzt, der Patient erhält eine Aufklärung über die ASV, es können mit ASV- Überweisung nur ASV teilnehmende Ärzte aufgesucht werden. Der Überweisungsschein sieht gleich aus, wie der bisherige Überweisungsschein, aber die ASV Team- Nummer ist anders. Die Überweisung gilt nur für Rheumadiagnosen, nicht für andere Erkrankungen.
In der ASV können auf Grund eines besonderen Abrechungsstatus schnelle Termine angeboten werden. Ein Patient kann jederzeit aus der ASV austreten.
Auch die Knochendichtemessung kostet den Patienten in der ASV nichts.
Die Patienten müssen keine schriftliche Einwilligung zur ASV geben, sondern müssen nur ausführlichen informiert und aufgeklärt werden. Eine Überweisung entfällt, wenn der Patient aus dem Krankenhaus kommt.
Die Chancen der ASV liegen in der interdisziplinären Besprechung des Patienten, in der Vernetzung, in der extrabudgetären Abrechnung und in der Einzelleistungsvergütung.
Die ASV ermöglichst den Zugang zu neuen Leistungen, z.B. PET- CT.
Die Vorteile der ASV sind eine gute Patientenversorgung, auch für seltene oder komplexe Erkrankungen, auch großzügige Verordnungen sind möglich. Es besteht eine gute Kooperation im Ärzte- Team. Es bestehen bessere Leistungsabrechungsmöglichkeiten.
Für die Patienten sind kurzfristige Termine möglich.
Weitere Informationen und notwendige Formulare: